Gespräch mit Regisseur Jan Bonny und Drehbuchautor Jan Eichberg

Jan Bonny, Jan Eichberg, ein "Tatort" in der speziellen Situation der alemannischen Fasnacht, wie kam es dazu und wieso war das reizvoll für Sie?
Jan Bonny: Katharina Dufner, die Redakteurin des "Tatorts", schlug vor, dass wir uns mal die Fasnacht als möglichen Ausgangspunkt anschauen. Wir waren dann gemeinsam in Elzach, und es war auch wirklich sehr gut, diese Verquickung von Rausch und Tradition zu erleben. In der Fasnacht steckt ja alles gleichzeitig drin. Es ist ein anarchisches Ritual, es geht um Herrschaft – wer im Ort ist im Narrenrat, wer steckt unter den Kostümen. Die Maskierung ist da auch ein Herrschaftsmittel, du weißt nicht, von wem du geschlagen wirst. Gleichzeitig ist es aber auch ein erotisches Spiel. Rausch, Enthemmung, Sexualisierung für eine bestimmte Zeit, das alles kommt da zusammen. Das fand ich interessant, weil es in seinem Ursprung auch eine bedrohlich heftige Veranstaltung ist. Es sollte in unserem Film nicht darum gehen, etwas zu erzählen wie »unter welcher Maske hat der Mörder gesteckt«. Das wollten wir bewusst nicht. Es ging vielmehr um die Masken- und Traummetapher. Der Traum von einem anderen Leben, der Traum von der anderen Möglichkeit, die Verkleidung als Mittel des Grenzübertritts. Strafe und Entgrenzung.
Jan Eichberg: Ich war später auch mit Katharina Dufner in Elzach und am Titisee. Das war ein sehr intensives Erlebnis, ähnlich wie du es beschrieben hast, Jan. Ich kannte ja nur Karneval. Dieses Element der Bestrafung war mir bis dahin unbekannt. Wir haben auch über das Element der Reinigung gesprochen, dass das die tollen Tage sind und mit dem Aschermittwoch geht man dann wie auf Null zurück. Wie Jan gerade beschrieben hat, waren das Maskieren und Demaskieren, der Versuch, jemand anderer sein zu wollen, anregend. Geheimnisse zu verbergen vor der Gesellschaft, aber auch vor sich selbst. Oder Wahrheiten zu verdrängen, so wie Romy Schindler, die ihre Vergangenheit vor sich selbst verbirgt.
Jan Bonny: Nicht nur.
Jan Eichberg: Klar, sie hat auch eine Sehnsucht nach früher. Weil das plötzlich eben nicht nur schlecht war, sondern gerade im Kontrast zur Gegenwart etwas Positives sichbarer zu werden scheint.
Jan Bonny: Zuerst interessierte uns diese Welt, und dann haben wir darin Figuren gefunden und sind denen gefolgt. Eine davon ist diese Romy Schindler. Die hat ihren Ursprung ein wenig in einer Geschichte, die wir mal in der Zeitung gefunden haben, über eine junge Frau, die aus dem Milieu raus ist und sich in die Provinz abgesetzt hatte, in einen kleinen Ort, und die dann zufällig von einem ehemaligen Freier wiedergefunden wurde. Durch dessen bloße Präsenz in diesem kleinen Ort wurde sie bloßgestellt und in dieser Kleinstadt wurden Fragen ausgelöst. Und plötzlich musste sich diese kleine Gesellschaft dazu positionieren und sie selbst auch. Bezeihungsewise hatte sie Angst, dass die Gesellschaft sich gegen sie stellen würde, und es ist ja ein interesannte Frage, ob diese Angst überhaupt berechtigt war. Das war so eine Geschichte, die wir wiedergefunden haben, als wir darüber nachdachten, was ist das Personal, mit dem wir in dieser Welt arbeiten? Das meine ich mit dem Nebel. Figuren, mit denen man sich schon mal beschäftigt hat, aber die man nie erzählt hat, die man mit sich rumträgt, werden irgendwann lauter und werden die, die man erzählt. Das ist ein organischer Prozess.
Das Motiv der Schönheitsklinik hat sich mit dem Maskenmotiv verbunden?
Jan Bonny: Schönheitskliniken sind ja in der Gegend ganz real. Durch die Fasnacht findet das zusammen, durch dieses Maskenspiel des Verbergens und Versteckens, des Aussteigens, der Ausnahmesituation. Wir haben alle möglichen Figuren mal darauf befragt, wie sie in dieser Ausnahmesituation anfangen, sich zu verhalten. Auch die Kommissare. In diesem Fall fängt alles mit Fasnacht an. Das ist tatsächlich der Strudel, der alle einfängt und alle ausspuckt.
Bei dieser Entwicklung hatten Sie zwei Kommissarfiguren als festes Element. Hat Sie gebremst oder angeregt?
Jan Eichberg: Das sind ja noch recht junge Kommissarsfiguren, die es noch nicht so lange gibt, das war ganz gut für uns. Wir konnten uns, in Absprache mit Katharina Dufner, offen Gedanken machen, in welche Richtung die gehen könnten, was wir interessant an ihnen finden. Und uns war auf jeden Fall klar, dass sie nicht nur eingesetzt werden sollten, um irgendwie einen 1000 mal gesehenen Fall zu lösen, während es eigentlich die ganze Zeit um die Täter geht. Sondern die beiden mussten auch Protagonisten sein, die sich mit dieser Welt auseinandersetzen. Die auch scheitern oder sich der Welt entgegenstemmen.
Jan Bonny: Ausschlaggebend dafür, dass wir den Film gemacht haben, war auch, dass die beiden das spielen. Es macht Spaß für die beiden zu schreiben und es macht Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Wir hatten ganz schnell das Gefühl, dass die beiden die wirklichen Hauptfiguren sind. Und das sind sie, auch wenn der Film nicht mit ihnen anfängt und sie erst nach womöglich einer Viertelstun de auftauchen. Und trotzdem sind sie die Hauptfiguren, weil durch die beiden hindurch unsere Wahrnehmung als Zuschauer läuft. Die beiden sind – was im Krimi eher unüblich ist, weil man sich meist auf investigative Vorgänge beschränkt – für uns Auge und Ohr und auch in einem ganz emotionalen Sinn Zugang zu dieser Welt und zur Beurteilung oder zum Nachdenken über alle anderen Figuren. Die Tatsache zum Beispiel, dass die beiden Figuren im Laufe des Films miteinander ins Bett gehen, ist kein äußerlich ausgedachter Vorgang, das muss sich ja geradezu so ergeben. Denn wenn der Strudel so stark ist, dass all die anderen Figuren hinein geraten, dann müssen die beiden Kommissare das auch. Dadurch sind sie auch auf Augenhöhe mit den anderen. Keine überlegenen, schuldlosen Figuren, sondern die beiden sind genauso menschlich miteinander in ihrer Auseinandersetzung, wie sie auch zart und vorsichtig sind und lustig und grob und verletzend. Und somit sind sie auch vom ersten Moment an Ermittler in einem Fall.
Der Mord passiert relativ spät in der Geschichte ...
Jan Bonny: Die Gewalt kommt ja schon am Anfang in den Film. Und zwar sofort und massiv. Am Anfang ist kein Mord, aber die Gewalttat, die passiert, hätte unter anderen Umständen zu einem Mord führen können. In der Fasnacht auf der Straße finden alle Übergriffigkeiten bereits statt. Von David Hans zu Romy, indem er sie da fast nötigt, diesen Schnaps zu trinken, sie wertet ihn andererseits vor dem Kind ab, dann kommen diese maskierten Figuren und nötigen und blamieren den Kommissar, seine Kollegin Tobler nimmt lachend teil. Die Vermischung von Gewalt und Annäherung ist sofort da, die körperliche Nähe ist sofort gefährlich, hat Konsequenzen und bleibt im Konflikt. Und dann kommt die Figur von Burk Giebenhein und trägt Bedrohung von außen hinein. Ab dem Moment ist Romy potentiell gefährdet. So wie man einen Film liest als Zuschauer, hätte das auch mit einem Mord enden können. Tut es nicht, aber der potentielle Mord ist da. Die Tat steht im Raum. Ganz klassisch, wenn eine Waffe gezeigt wird, muss sie auch abgefeuert werden. Deshalb akzeptiert man das hoffentlich überhaupt, dass es so lange nicht zur eigentlichen Tat kommt. Wir wissen durch unsere Seh-Erfahrung um das Potential der Figuren und verstehen, auch wenn wir es nicht direkt miterleben, wie es dann zum Mord gekommen sein kann. Wir lesen Filme mit einem riesigen Wissen um solche Erzählungen. Das ist ja nicht anders als beim Kasperletheaterstück. Wir wissen, um wen wir uns zu sorgen haben, wir wissen, wer potentiell in Aktion treten könnte.
Sie haben auch während der Dreharbeiten noch am Drehbuch weitergearbeitet?
Jan Eichberg: Wir haben immer wieder überprüft, was wir gedreht haben und dann bei Bedarf die Szenen für den nächsten Drehtag nochmal bearbeitet. Wir haben nicht die Geschichte verändert, aber nachgeschärft, es ging vor allem um Genauigkeit in den Dialogen. Aber die Sprache der Figuren, die Konflikte der Figuren, da habe ich kontinuierlich weitergearbeitet. Das haben auch alle gut verkraftet. Das hatten wir vorher schon bei unserem gemeinsamen Kinofilm gemacht. Warum auch nicht, warum nicht noch mal besser werden beim Schreiben. Die Chancen werden oft verschenkt. Wenn man sich im Rahmen der verabredeten Szenen bewegt und die Schauspieler sich darauf einlassen, die ja öfter mal noch einen neuen Text kriegen, dann ist das eigentlich eine Chance, die außerdem Spaß macht. Wir haben das Schreiben als organischen Teil des Filmemachens behandelt und nicht als abgeschlossenen Schritt. Das geht nach dem Dreh ohnehin weiter, denn Schneiden ist ja nichts anderes als Schreiben. Beim Schneiden schreibt man ja um. Und hebt und senkt und verbirgt und zeigt. Das haben wir einfach in gewisser Weise auch beim Dreh weitergeführt. Vor allem Jan, denn ich war ja mit dem Schreiben beschäftigt.
Erfodert Ihre Art zu inszenieren, Jan Bonny, einen besonderen Plan mit dem Kameramann?
Jan Bonny: Ein Film wie diesen zu drehen ist eine sensible Sache. Als Kameramann, vor allem auch wenn es Handkamerasequenzen sind, muss man sich mit ähnlicher Lust und einem ähnlichen Instinkt und einer Aufmerksamkeit in die Szenen reinbegeben wie die Schauspieler auch. Man spielt auf eine Art mit. Das tut man natürlich in einem Rahmen, den ich bereitstelle. Ich will das ja alles zusammenführen, die Orte, die Kostüme, die Schauspieler, die Kamera. Aber ohne den einzelnen die eigenen Interessen nehmen zu wollen, sondern im besten Fall um die alle zum gegenseitigen Besten zusammenzuführen. Ich glaube, dass das Stefan Sommer Spaß gemacht hat. Es war ziemlich anstrengend, weil wir mehr gedreht haben als sonst so üblich. Man muss sich bei Fernseharbeiten ja entscheiden, wo man die Zeit einsetzen will. Und da ist die Arbeit mit den Schauspielern grundsätzlich am wichtigsten. Das Bild entsteht im allerbesten Fall durch Teilnahme und große Aufmerksamkeit und Sensibilität, und dabei ist Stefan gut in den Fluss reingekommen. Die Ausstatterin Julia Baumann spielt da auch eine große Rolle, genau wie die Kostümbildnerin Ulrike Scharfschwerdt. Letztlich arbeitet man ja mit Schauspielern eben auch über Motive, man arbeitet mit Schauspielern über Orte, man arbeitet mit Schauspielern über Kostüme, durch die Besetzung der anderen Rollen. Schauspielführung findet ja nicht erst in dem Moment statt, in dem man am Set steht. Im allerbesten Fall ergibt sich, wenn die einzelnen Teile zusammenkommen, eine Dynamik, es kostet nicht Kraft, sondern es entsteht Kraft.
Wie kam es zu der ganz besonderen Musik von Jens Thomas?
Jens Thomas macht mit Matthias Brandt Bühnenprogramme. Ich habe die beiden auch mal getroffen und mir gedacht, dass das gut passen können. Wir beschlossen, dass wir es ausprobieren. Und dann hat er losgelegt. Es gibt ja ein Heinrich-Heine-Motiv in dem Film, die beiden Kommissare singen am Anfang die Loreley, Ich weiß nicht, was soll es bedeuten … Die Loreley, die Verführung, das Zerschellen, der romantische Rhein. Bei Jens‘ ersten Vorschlägen waren auch schon Schumann-Lieder, das sind auch wieder Heine-Texte. Das, was er daraus gemacht hat, ist ein ganz hörbarer Score. Das ist keine Musik, die sich verbirgt und für die Unaufmerksamen jedes Gefühl verstärkt, mit Synthieflächen, wenn‘s irgendwie mysteriös wird, und Streichern, wenn‘s schön wird. Die Musik ist, wenn man so will, nochmal eine eigene Figur. Ein Erzähler neben dem anderen, der eine eigene Perspektive mit sich bringt. Und das führt interessanterweise dazu, dass einem Stellen auffallen, die einem ohne Musik nicht auffallen würden. Die Musik hebt aus diesen Bildern und Szenen, die ja oft hart und übergriffig sind, das Schöne. Um in dem schon verwendeten Bild zu bleiben: dann steigt ein anderer Geist daraus hervor. Eine bestimmte Schönheit, eine bestimmte Sehnsucht, die man sonst vielleicht gar nicht bemerkt hätte. Die Musik erzählt dann davon. Ich glaube, das geht nur deswegen so gut, weil es in dem Film Britney Spears und die Backstreet Boys als Sourcemusik gibt. Im Film ist schon eine expressive Gesangswelt vorhanden. Da singen immer schon Leute mit, dann kann der Erzähler auch singen.

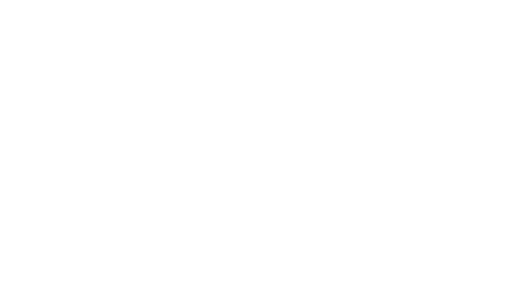
Kommentare